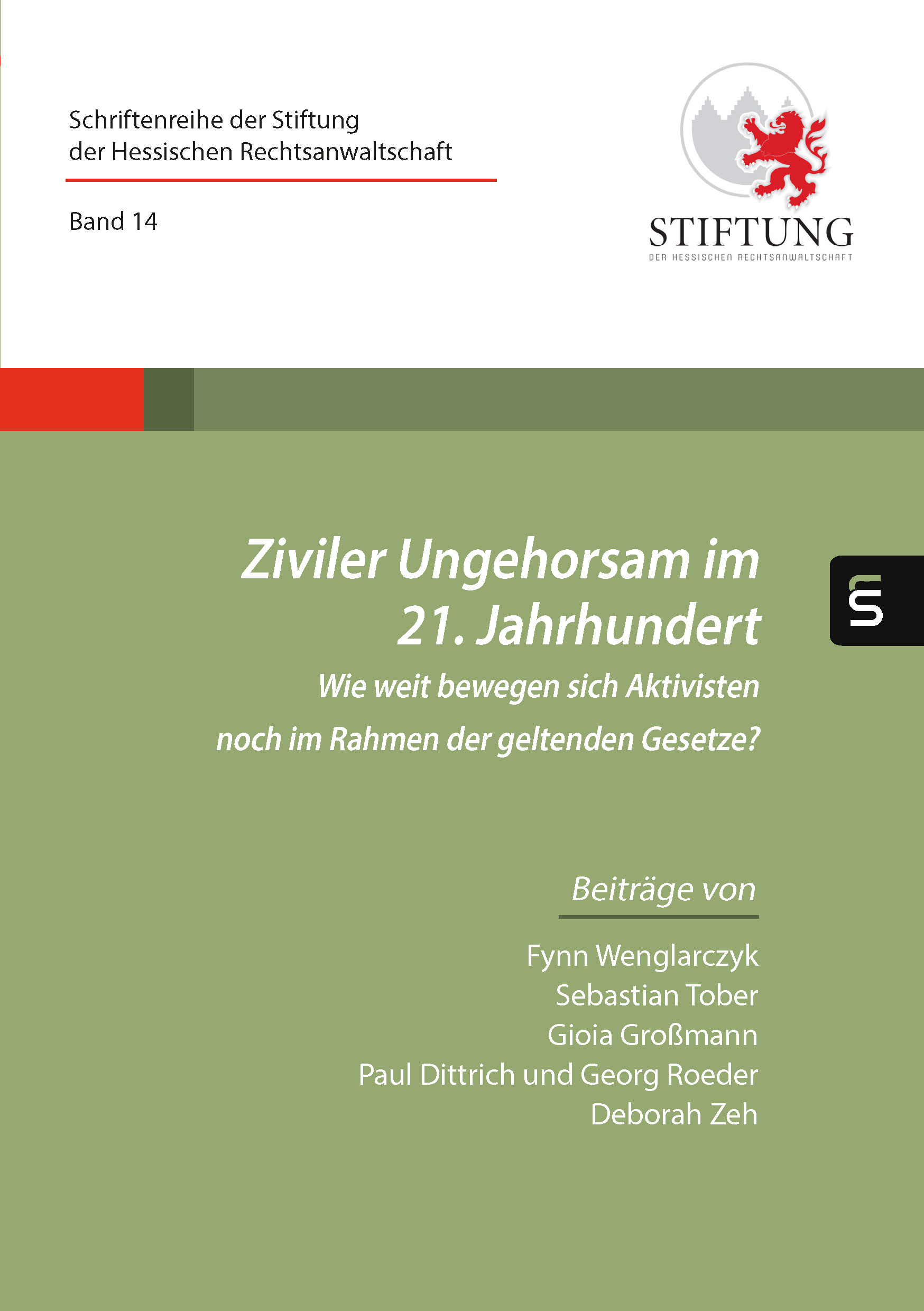Ziviler Ungehorsam im 21. Jahrhundert
Ziviler Ungehorsam ist eine bewusste Grenzüberschreitung im Spannungsfeld zwischen demokratischem Protest und rechtsstaatlicher Ordnung. Beispiele wie die „68er-Bewegung“, Brokdorf, Gorleben, der Hambacher Forst, „Black Lives Matter“, „Fridays for Future“ oder die „Letzte Generation“ zeigen, wie emotional aufgeladene gesellschaftliche Konflikte in öffentliche Protestformen münden, die gezielt das Recht herausfordern. Dabei stellen sich komplexe juristische Fragen: Wann ist eine Aktion noch durch Meinungsfreiheit gedeckt, wann überschreitet sie die Schwelle zur Nötigung oder zur kriminellen Vereinigung? Wie lassen sich moralische Motive rechtlich bewerten? Diese Fragen und ihre juristischen Implikationen werden in diesem Band differenziert und fundiert diskutiert.
26,90 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beschreibung
In einer zunehmend polarisierten Gesellschaft, die mit globalen Krisen und wachsender politischer Unzufriedenheit konfrontiert ist, rückt der Umgang mit zivilem Ungehorsam stärker ins Zentrum rechtlicher und gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Protestformen wie Sitzblockaden, Straßen- oder Baumbesetzungen werfen die Frage auf, wie weit Aktivist:innen im Rahmen einer demokratischen Ordnung gehen dürfen – und wo der Staat klare Grenzen setzen muss.
Ziviler Ungehorsam bezeichnet gewaltfreie Regelverstöße, die aus moralischer Überzeugung öffentlich begangen werden, um auf Missstände hinzuweisen. Gerade wenn sich Protestbewegungen auf ein übergeordnetes Gemeinwohl berufen – etwa beim Klimaschutz –, geraten zentrale Rechtsnormen wie der rechtfertigende Notstand (§ 34 StGB), die strafbare Nötigung (§ 240 StGB) oder das Verbot krimineller Vereinigungen (§ 129 StGB) in den Fokus juristischer Bewertung. Dabei geht es nicht nur um Strafrecht, sondern auch um zivilrechtliche Folgen und den verfassungsrechtlichen Rahmen zwischen Meinungsfreiheit, öffentlicher Ordnung und Verhältnismäßigkeit.
Diese komplexen Fragen beleuchtet der 14. Band der Schriftenreihe der Stiftung der Hessischen Rechtsanwaltschaft. Die prämierten Beiträge eines bundesweiten Aufsatzwettbewerbs, ausgewählt durch Dr. Rainald Gerster, Präsident des Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main, zeigen, wie unterschiedlich zivilgesellschaftlicher Protest juristisch eingeordnet werden kann – und warum er trotz aller Spannungen eine differenzierte rechtliche und gesellschaftliche Auseinandersetzung verdient.
Zusätzliche Informationen
| Auflage | 1 |
|---|---|
| ISBN | 978-386376-276-6 |
| EAN | 9783863762766 |
| Titel | Ziviler Ungehorsam im 21. Jahrhundert |
| Untertitel | Wie weit bewegen sich Aktivisten noch im Rahmen der geltenden Gesetze? |
| Autor | Deborah Zeh, Fynn Wenglarczyk, Georg Roeder, Gioia Großmann, Paul Dittrich, Sebastian Tober |
| Reihe | Schriftenreihe der Stiftung der Hessischen Rechtsanwaltschaft |
| Band | 14 |
| Herausgeber | |
| Gutachter | Dr. Rainald Gerster |
| Erscheinungsdatum | 07.05.2024 |
| Erscheinungsjahr | 2024 |
| Verlag | Sieversmedien |
| Ausgabeart | Softcover |
| Sprache | deutsch |
| Seiten | 264 |
| Medium | Buch, E-Book |
| Produkttyp | Fachbuch, Sammelband |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Sievers & Partner
Erfurter Str. 10
96450 Coburg
Deutschland (Bayern)
Tel: +49 9561 6754754
E-Mail: info@elitebuch.com
Alle auf dieser Seite angebotenen Produkte entsprechen den geltenden gesetzlichen Vorschriften zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).