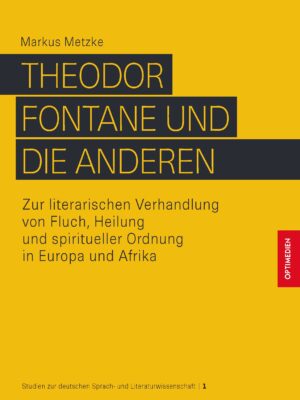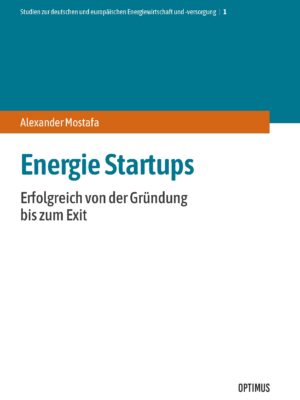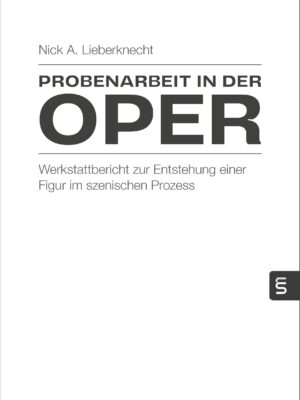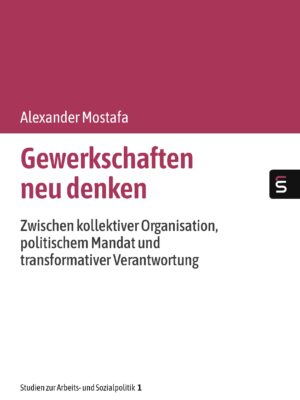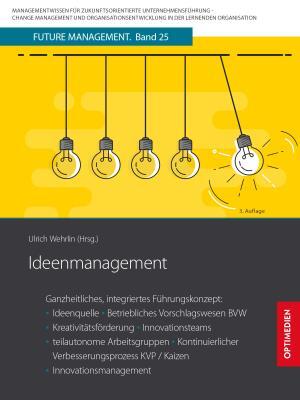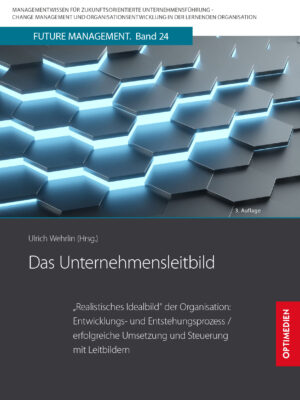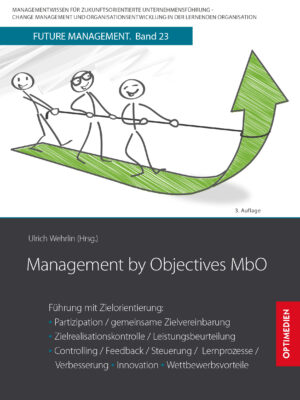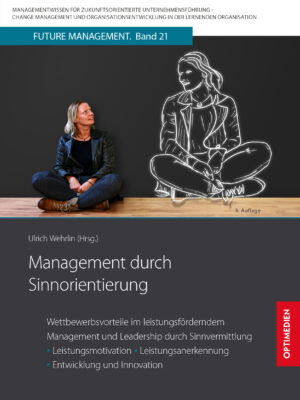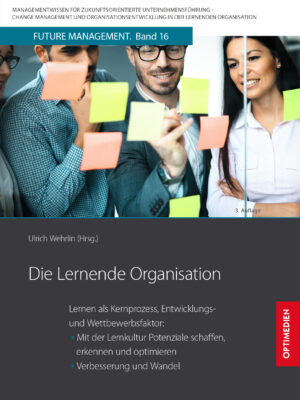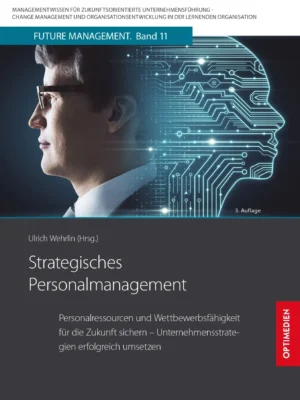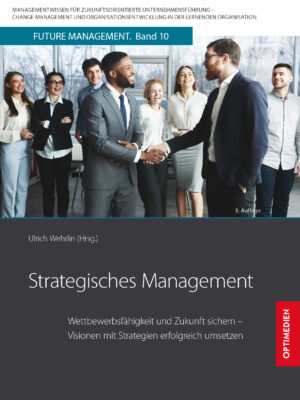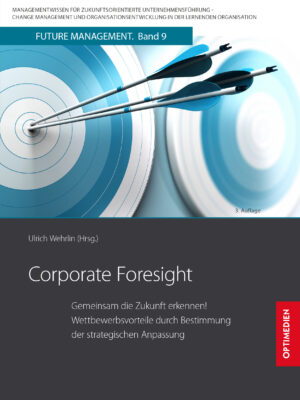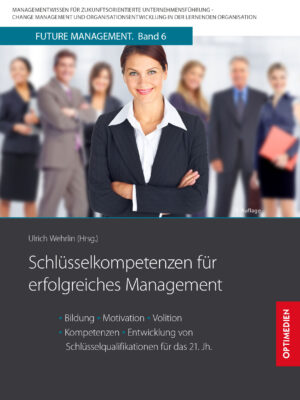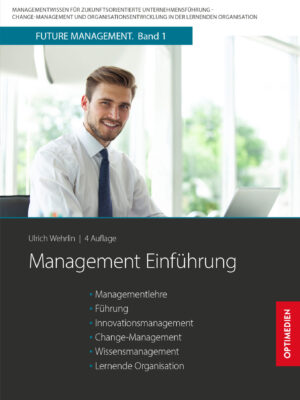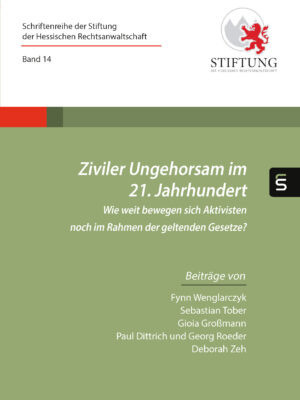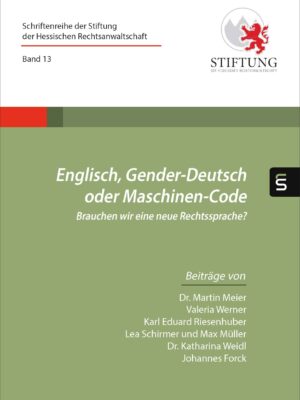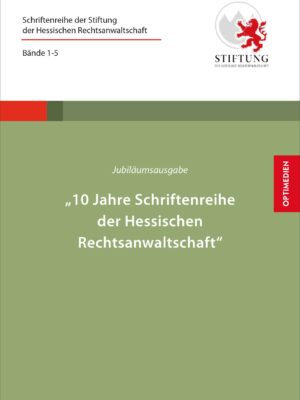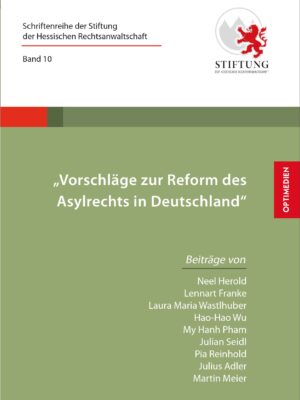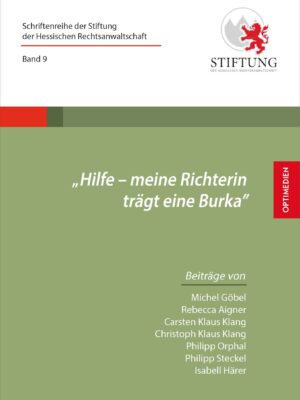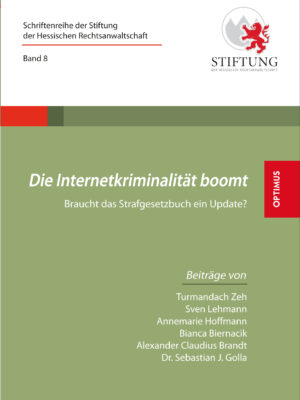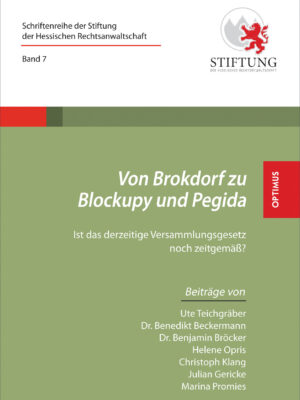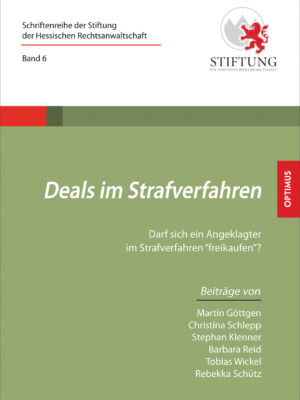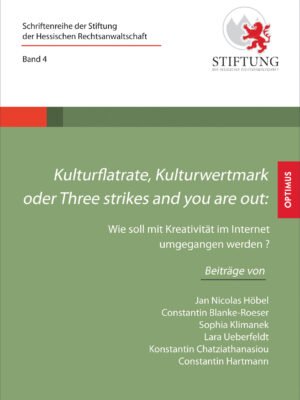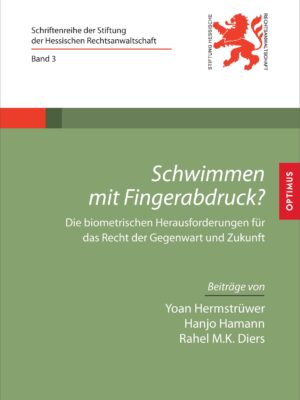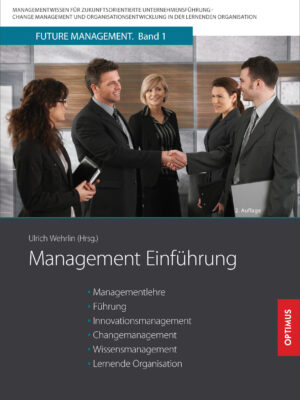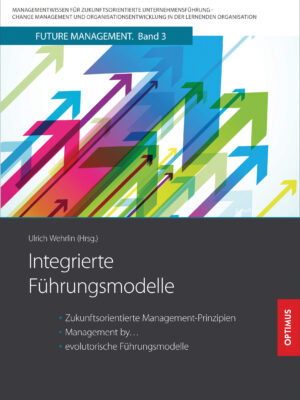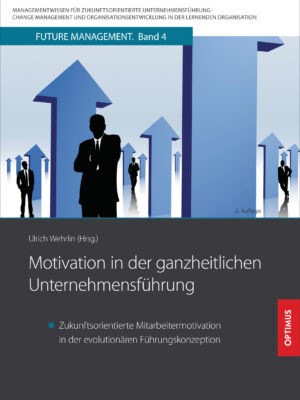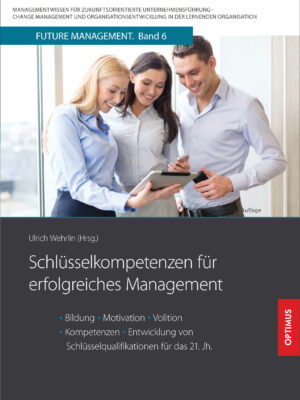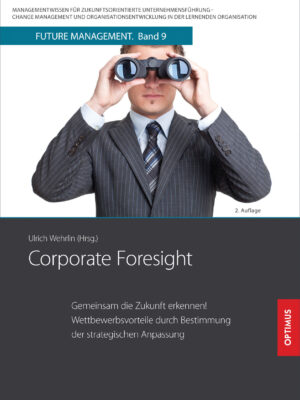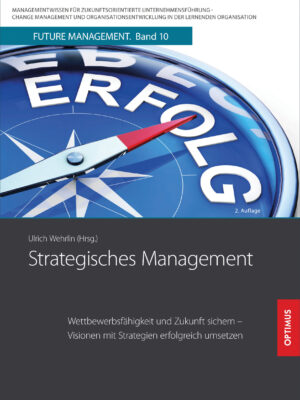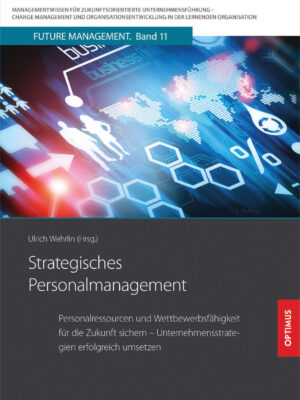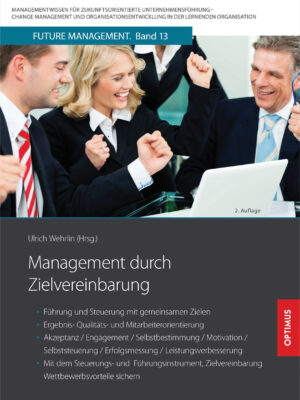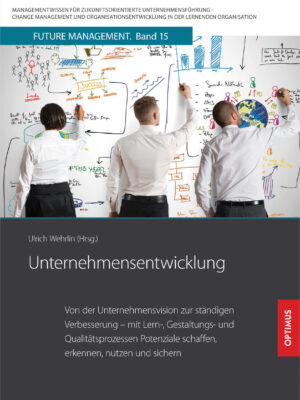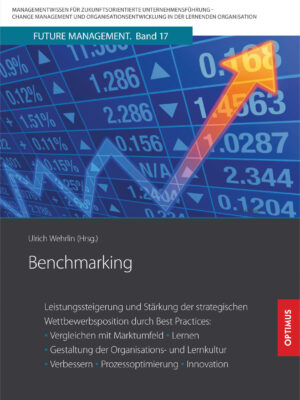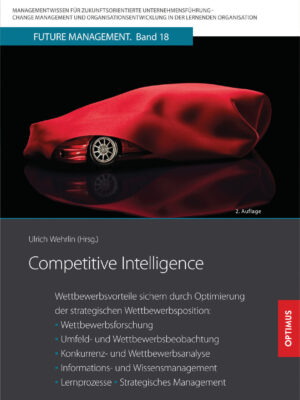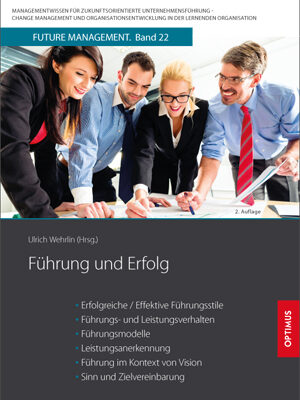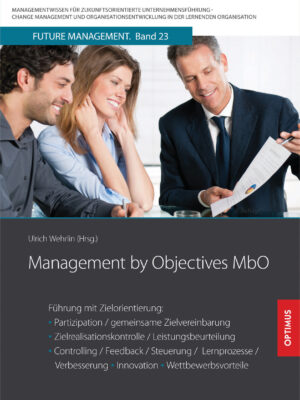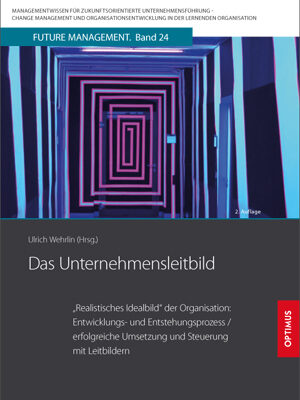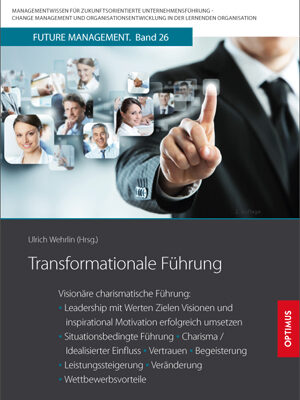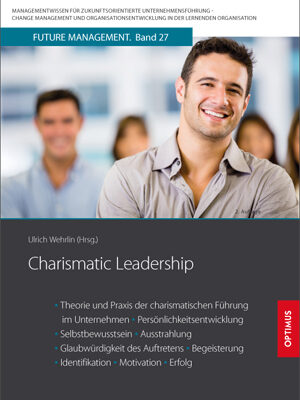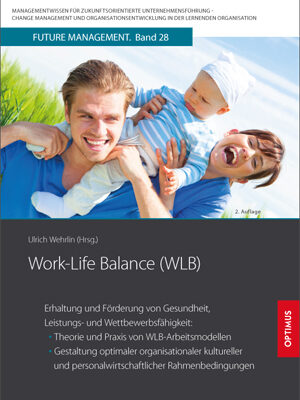Verfassungsfeindliche Parteien in Deutschland
Das Grundgesetz schützt politische Parteien umfassend – selbst dann, wenn sie verfassungsfeindliche Ziele verfolgen, solange sie nicht durch das Bundesverfassungsgericht verboten wurden (Art. 21 GG). Dieses sogenannte Parteienprivileg sichert die Chancengleichheit im politischen Wettbewerb. Zugleich erschwert es dem Staat, auf verfassungsfeindliche Aktivitäten unterhalb der Verbotsgrenze wirksam zu reagieren.
Ein Parteiverbot ist nur unter hohen verfassungsrechtlichen Hürden möglich, wie das Bundesverfassungsgericht zuletzt im NPD-Verfahren 2017 betonte¹. Dennoch können Behörden wie der Verfassungsschutz Parteien beobachten und öffentlich benennen, was sich etwa auf deren Zugang zu öffentlichen Ämtern oder Ressourcen auswirken kann. Diese Spannung zwischen politischer Freiheit und demokratischer Abwehrbereitschaft ist juristisch und politisch umstritten.
Im Zentrum steht die Frage, wie der Staat auf verfassungsfeindliche Parteien reagieren kann, ohne zentrale Verfassungsprinzipien wie Pluralismus und Rechtsstaatlichkeit zu gefährden.