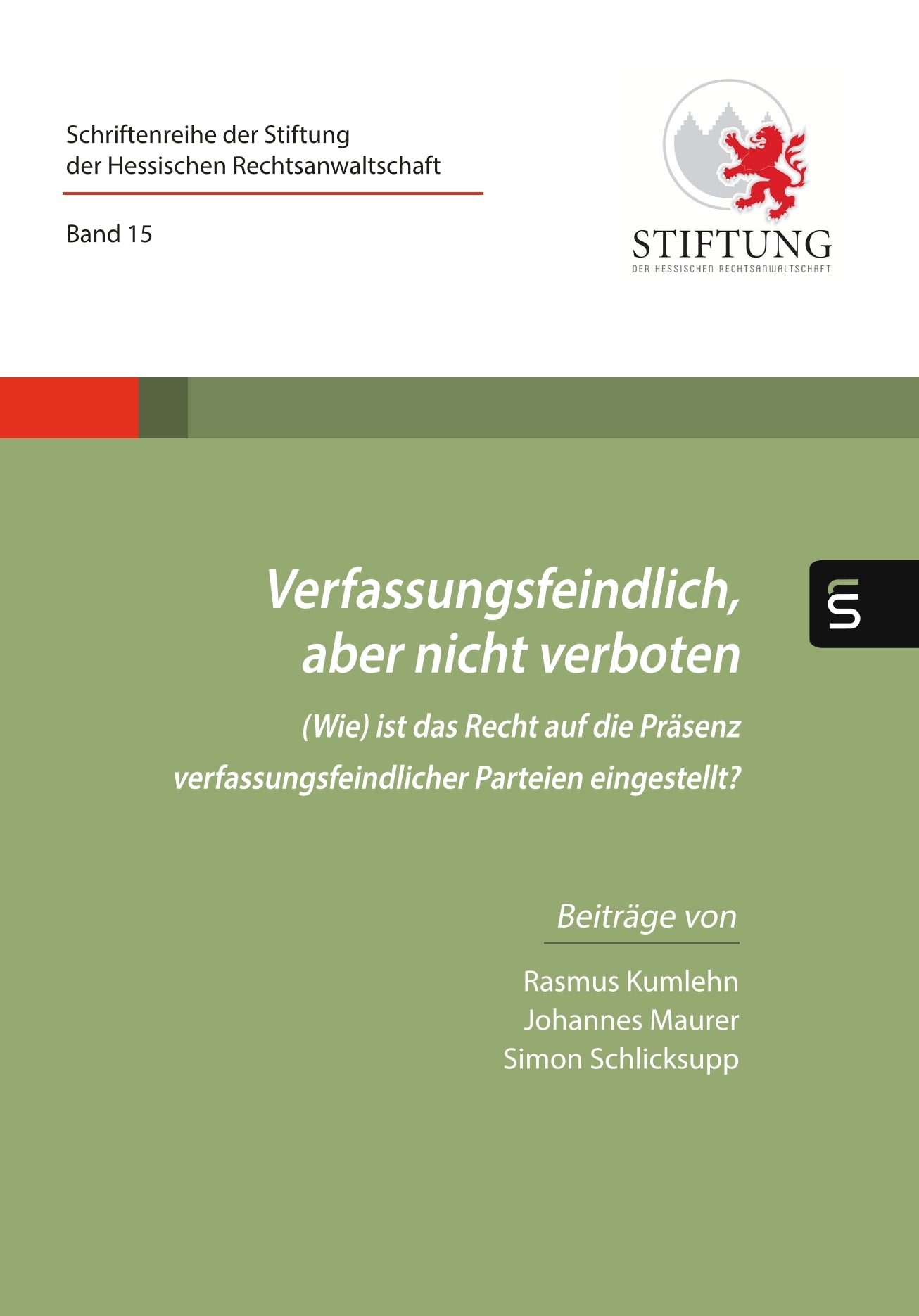Verfassungsfeindlich, aber nicht verboten
Der 15. Band der Schriftenreihe der Stiftung der Hessischen Rechtsanwaltschaft beleuchtet das Spannungsfeld zwischen dem Parteienprivileg des Grundgesetzes und dem Umgang mit verfassungsfeindlichen Parteien, die nicht verboten sind. Die prämierten Beiträge des bundesweiten Aufsatzwettbewerbs 2024 analysieren aktuelle verfassungsrechtliche Herausforderungen mit juristischer Klarheit und gesellschaftspolitischer Relevanz. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Gabriele Britz, Richterin des Bundesverfassungsgerichts a. D.
34,90 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Zwischen Parteienprivileg und Verfassungsfeindlichkeit: Wie wehrhaft ist die Demokratie?
Das deutsche Grundgesetz garantiert in Artikel 21 Absatz 1 die Freiheit der politischen Parteien und misst ihnen eine zentrale Rolle in der politischen Willensbildung zu. Zugleich schützt das sogenannte Parteienprivileg in Artikel 21 Absatz 4 Parteien, die nicht durch das Bundesverfassungsgericht verboten wurden, vor diskriminierender staatlicher Behandlung. Dieses Schutzregime sichert die Chancengleichheit im politischen Wettbewerb – auch gegenüber Parteien mit verfassungsfeindlichen Zielen, solange sie nicht verboten sind.
Gleichzeitig steht der demokratische Verfassungsstaat vor der Herausforderung, auf extremistische und antidemokratische Tendenzen innerhalb dieses Rahmens zu reagieren. Denn ein Parteiverbot gemäß Artikel 21 Absatz 2 GG unterliegt hohen verfassungsrechtlichen Hürden: Es bedarf nicht nur des Nachweises einer aktiv kämpferischen Haltung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, sondern auch eines konkreten „darauf Ausgehens“, diese Ordnung zu beseitigen. Diese Voraussetzungen wurden durch das Bundesverfassungsgericht – insbesondere im Urteil zum NPD-Verbotsverfahren 2017 – nochmals verschärft.
In der Praxis führt dies dazu, dass Parteien über Jahre hinweg verfassungsfeindliche Bestrebungen entfalten können, ohne verboten zu werden. Staatliche Behörden – insbesondere die Verfassungsschutzämter – beobachten solche Parteien und benennen ihre Aktivitäten öffentlich, etwa in Verfassungsschutzberichten. Diese Beobachtung wiederum hat faktische Auswirkungen, etwa bei der Vergabe öffentlicher Ämter, in Zuverlässigkeitsprüfungen (etwa im Waffen- oder Gewerberecht) oder bei der Besetzung parlamentarischer Gremien.
Dieses Spannungsverhältnis zwischen politischer Freiheit und demokratischer Wehrhaftigkeit wirft grundlegende Fragen auf: Wie weit reicht der Schutz des Parteienprivilegs in der Praxis? Welche rechtlichen Instrumente stehen dem Staat zur Verfügung, um auf verfassungsfeindliche Aktivitäten unterhalb der Verbotsgrenze zu reagieren? Und wie kann dabei eine Balance gewahrt bleiben zwischen politischer Pluralität, staatlicher Neutralität und dem Schutz der Verfassungsordnung?
Die Diskussion ist hochaktuell, nicht zuletzt im Kontext der Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz. Juristisch wie politisch stellt sich die Frage, ob das bestehende Instrumentarium ausreichend ist, um auf verfassungsfeindliche Parteien angemessen zu reagieren, ohne das Gebot der Chancengleichheit zu verletzen – oder ob gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht.
Zusätzliche Informationen
| Auflage | 1 |
|---|---|
| EAN | 9783863762797 |
| ISBN | 978-3-86376-279-7 |
| Titel | Verfassungsfeindlich, aber nicht verboten |
| Untertitel | (Wie) ist das Recht auf die Präsenz verfassungsfeindlicher Parteien eingestellt? |
| Autor | |
| Reihe | Schriftenreihe der Stiftung der Hessischen Rechtsanwaltschaft |
| Band | 15 |
| Herausgeber | |
| Erscheinungsdatum | 06.05.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Verlag | Sieversmedien |
| Ausgabeart | Softcover |
| Sprache | deutsch |
| Seiten | 162 |
| Medium | Buch, E-Book |
| Produkttyp | Fachbuch, Sammelband |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Sievers & Partner
Erfurter Str. 10
96450 Coburg
Deutschland (Bayern)
Tel: +49 9561 6754754
E-Mail: info@elitebuch.com
Alle auf dieser Seite angebotenen Produkte entsprechen den geltenden gesetzlichen Vorschriften zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).