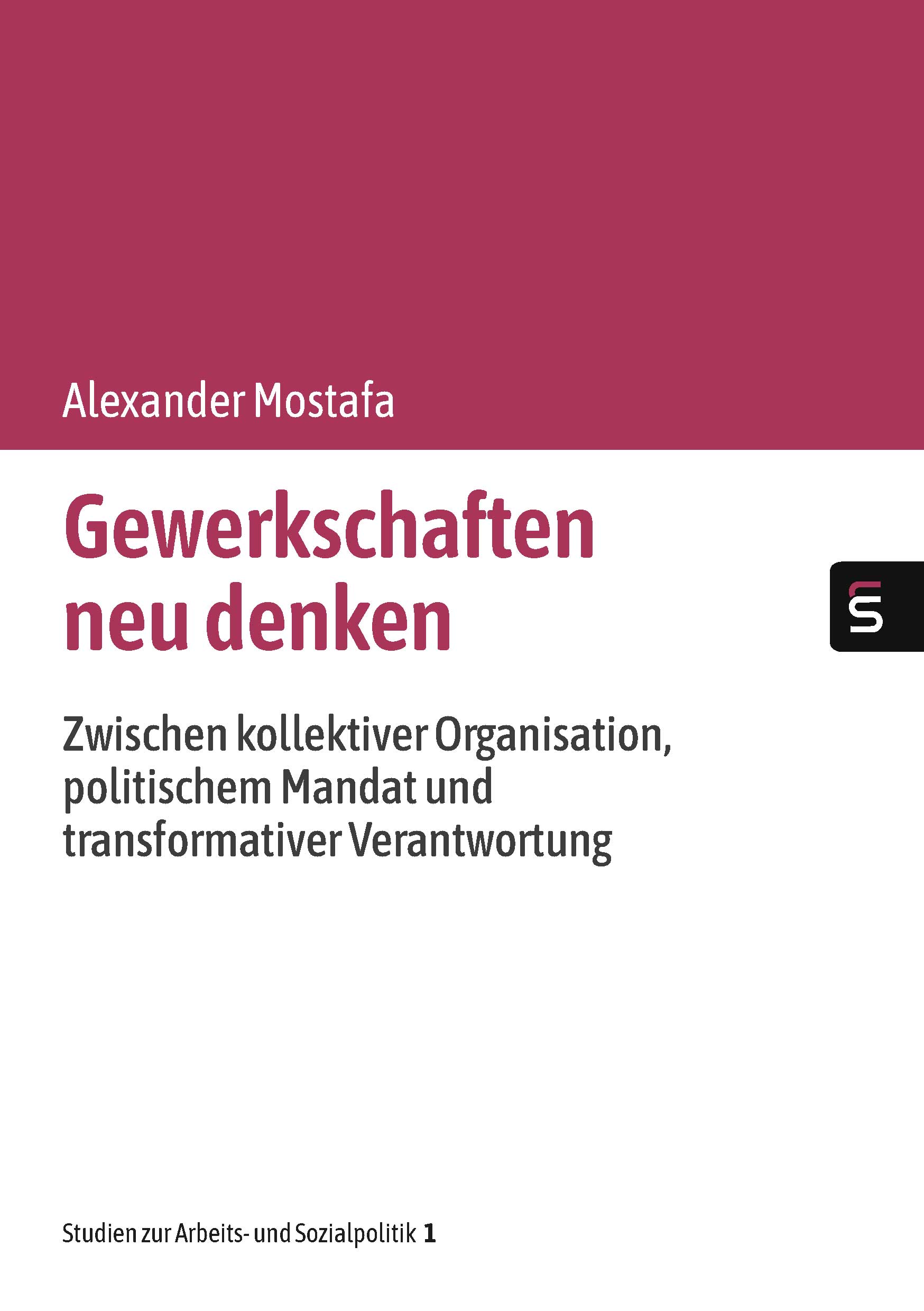Gewerkschaften neu denken
Gewerkschaften stehen im 21. Jahrhundert vor einem doppelten Legitimationsproblem: Sie kämpfen nicht nur mit strukturellen Machtverschiebungen infolge von Globalisierung, Digitalisierung und politischem Wandel, sondern auch mit dem Verlust ihrer gesellschaftspolitischen Gestaltungskraft. Diese Studie geht der Frage nach, wie sich Gewerkschaften neu positionieren können – jenseits klassischer Bündnisse mit sozialdemokratischen Parteien und angesichts zunehmender transnationaler Herausforderungen. Im Mittelpunkt steht die Revitalisierung des politischen Mandats von Gewerkschaften: Welche Strategien ermöglichen neue Allianzen, mehr Mobilisierungskraft und eine Rückgewinnung öffentlicher Relevanz? Die Analyse kombiniert theoretische Grundlagen mit aktuellen Fallbeispielen wie der Amazon-Kampagne oder den Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst und bietet einen differenzierten Blick auf die Zukunft gewerkschaftlicher Interessenvertretung im gesellschaftlichen Umbruch.
Ursprünglicher Preis war: 29,90 €Subskriptionspreis: 19,90 €Aktueller Preis ist: 19,90 €.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beschreibung
In einer Zeit tiefgreifender Umbrüche steht die Gewerkschaftsbewegung vor zentralen strategischen Herausforderungen. Das Buch Gewerkschaften neu denken analysiert den gegenwärtigen Wandel gewerkschaftlicher Interessenvertretung im Kontext globaler ökonomischer und politischer Transformationsprozesse. Sinkende Mitgliederzahlen, veränderte Arbeitsstrukturen, ein strategischer Bedeutungsverlust auf politischer Ebene sowie die Auflösung traditioneller Bündnisse mit sozialdemokratischen Parteien prägen den aktuellen Diskurs – und werfen zugleich die Frage nach einer grundlegenden Neuausrichtung auf.
Die Studie bietet eine fundierte theoretische und historische Einordnung der Gewerkschaften im Kapitalismus, diskutiert klassische Funktionsmodelle (u. a. Neumann, Hyman) und zeichnet die Entwicklung vom Ordnungsfaktor zur Gegenmacht nach. Im Zentrum steht die Untersuchung des politischen Mandats von Gewerkschaften: Wie lässt sich dieses legitimieren? Welche strukturellen Entwicklungen haben seine Erosion begünstigt? Und wie können Gewerkschaften es im 21. Jahrhundert neu begründen?
Empirisch unterlegt wird die Analyse mit aktuellen Entwicklungen wie der internationalen Kampagne „Make Amazon Pay“, Tarifkonflikten im öffentlichen Dienst und in der Bahnbranche sowie mit Daten zur Vertrauensentwicklung in gewerkschaftsnahe Institutionen. Die Arbeit greift dabei auch auf internationale Perspektiven zurück und diskutiert Ansätze wie „Organizing“ und „Social Movement Unionism“ als mögliche Strategien zur Revitalisierung gewerkschaftlicher Handlungsfähigkeit.
Ziel der Publikation ist es, neue Wege für Gewerkschaften aufzuzeigen, wie sie sich als gesamtgesellschaftliche Akteure positionieren und in Zeiten politischer Polarisierung und ökonomischer Fragmentierung handlungsfähig bleiben können. Die interdisziplinäre Methodik verbindet arbeitssoziologische, politikwissenschaftliche und historische Zugänge zu einer umfassenden Analyse gewerkschaftlicher Zukunftsperspektiven.
Das Buch richtet sich an Wissenschaftler:innen und Studierende der Sozialwissenschaften – insbesondere mit Schwerpunkten in Arbeitssoziologie, politischer Ökonomie und Gewerkschaftsforschung – sowie an gewerkschaftliche Praktiker:innen, politische Entscheidungsträger:innen und gesellschaftlich Interessierte, die nach fundierten Antworten auf die Zukunftsfragen der kollektiven Interessenvertretung suchen.
Zusätzliche Informationen
| Auflage | 1 |
|---|---|
| EAN | 9783863762810 |
| ISBN | 978-3-86376-281-0 |
| Titel | Gewerkschaften neu denken |
| Untertitel | Zwischen kollektiver Organisation, politischem Mandat und transformativer Verantwortung |
| Autor | |
| Reihe | |
| Band | 1 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Verlag | Sieversmedien |
| Ausgabeart | Softcover |
| Sprache | deutsch |
| Medium | Buch, E-Book |
| Produkttyp | Fachbuch |
| Besonderheit | Erscheint 2025 |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Sievers & Partner
Erfurter Str. 10
96450 Coburg
Deutschland (Bayern)
Tel: +49 9561 6754754
E-Mail: info@elitebuch.com
Alle auf dieser Seite angebotenen Produkte entsprechen den geltenden gesetzlichen Vorschriften zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).